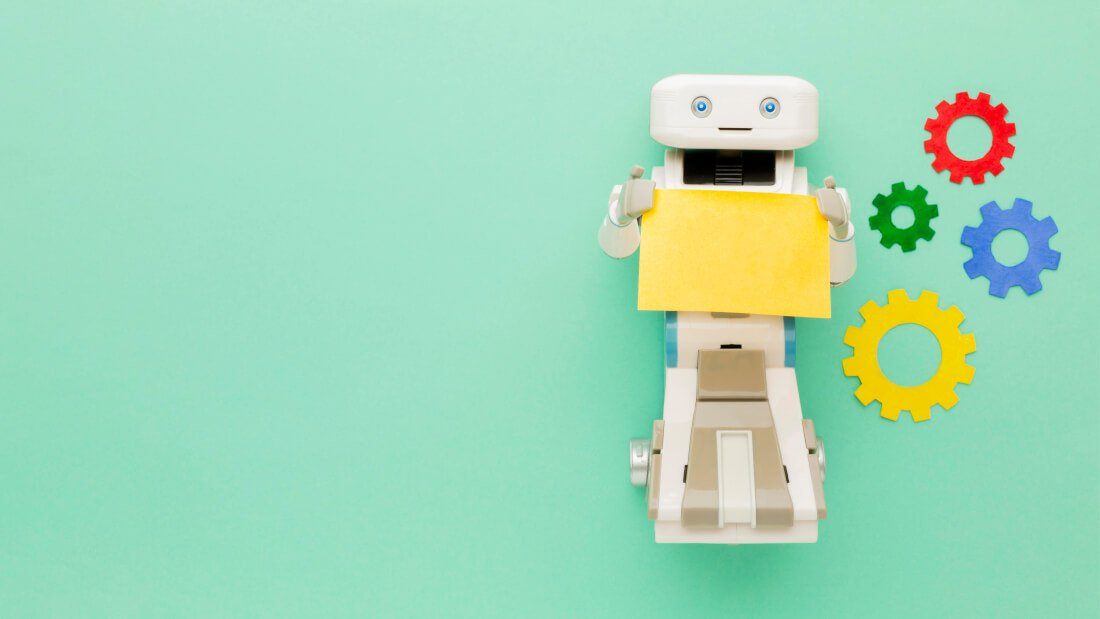Transitions- und Transformationsplan: Wie? Was? Warum?
Sinn und Zweck von der Erstellung von Transformations- oder Transitionsplanungen ist der Aufbau von Resilienz und Anpassungsfähigkeit zur Zukunftssicherung von Unternehmen. Zentral geht es um die Frage, wie Unternehmen und wir als Gesellschaft zum Ziel kommen. Was steht dahinter?
1988 wurde der IPCC gegründet und damit wurden wissenschaftliche Erkenntnisse zum Klimawandel für politische Entscheidungsträger bewertet. Es folge 1992 die Unterzeichnung des UNFCCC in Rio de Janiero, das die Grundlage für ein Rahmenabkommen für eine internationale Klimapolitik legt. Erstmals gab es Verpflichtungen von Industrieländern, die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren und es wurde die Voraussetzungen für den Emissionshandel gelegt. 2006 legte dann der Stern-Report offen, dass das „Nicht-Handeln“ die Kosten des „Handelns“, also der Umsetzung von Maßnahmen gegen den Klimawandel, übersteigen. Sie fragen sich nun - Was hat das mit Transitions- bzw. Transformationsplänen und (meinem) Unternehmen und dessen Finanzierung zu tun?
Was hinter den Transitions- bzw. Transformationsplänen steht
Im Kern geht es bei Transitions- bzw. Transformationsplänen um den Aufbau von Resilienz und Anpassungsfähigkeit zur Zukunftssicherung von Unternehmen und ganzen Gesellschaften. Diese begründen sich in einer Reaktion auf die Veränderungen durch den Klimawandel sowie weiteren ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen. Das Zielbild einer zukunftsfähigen, angepassten und wirtschaftlich erfolgreichen Gesellschaft wird durch den EU Green Deal gezeichnet. Daraus ergeben sich auch regulatorische Vorgaben für Unternehmen und Finanzinstitute.
In diesem Kontext stellt sich für Unternehmen und Finanzinstitute die zentrale Frage, wie Klima- und Nachhaltigkeitsziele konkret in der Unternehmensstrategie, entlang der Wertschöpfungskette, den Verantwortlichkeiten und im Geschäftsmodell verankert sind. Für einen Glaubwürdigen Transformations- oder Transitionsplan braucht es darüber hinaus Transparenz über die Chancen und Risiken.
Dabei werden physische Risiken, wie akute Extremwettereignisse und chronische Risiken, wie langsame Veränderungen in der Umwelt, unterschieden. Übergangsrisiken können politischer oder rechtlicher Natur sein, technologische Entwicklungen oder Veränderungen am Markt umfassen oder die Reputation betreffen. Zu den Chancen werden Ressourceneffizienz, die Energiewende, neue Produkte und Dienstleistungen, Widerstandsfähigkeit und Zugang zu Kapital genannt.
Rahmen- und Referenzwerke für Transformations- oder Transitionspläne
Das Pariser Klimaabkommen ist ein globaler Konsens auf eine Erderwärmung von unter 2 Grad. Der Sonderbericht des IPCC von 2018 zeigt jedoch deutlich, dass es einen großen Unterschied zwischen dem 1,5 und 2 Grad-Ziel gibt. Bei über 1,5 Grad Erderwärmung sind die Risiken und (finanziellen) Schäden weit aus gravierender, weitreichender und irreversibler. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse mündeten in Rahmenwerke für Unternehmen und Finanzinstitutionen. Es kristallisierten sich Standards und Rahmenwerke heraus, die die Bedeutung von Übergangsplänen betonen.
Die CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) der EU ist ein Rahemenwerk zur Nachhaltigkeitsberichterstattung inkl. definierter Standards für Unternehmen. Dieser gibt vor, dass Unternehmen nicht nur den IST-Zustand dokumentieren und offenlegen, sondern auch Ziele und Maßnahmen definieren müssen, die einen Beitrag zur Erreichung des EU Green Deals leisten. Dabei wird eine „Übergangsplanung“ erfordert: Warum sind diese Ziele relevant? Bis wann und wie sollen sie erreicht werden? Wer ist verantwortlich? Wie passt es in die gesamte Unternehmensstrategie? Welche Chancen und Risiken gibt dabei? Wie lässt sich der Fortschritt messen? Wie wird der Übergang finanziert?
Auch der ISBB-Standard (IFRS S1 und S2), der die Grundlage für Finanzinformationen bildet, betont die Bedeutung von Transitionsplänen. Vor allem in Bezug auf das Klima haben sich globale Standards und Benchmarks entwickelt. Diese basieren auf einer Berechnung der Treibhausgasemissionen eines Unternehmen nach klaren Kriterien, einer Orientierung an dem Transitionspfad zur Klimaneutralität nach dem Pariser Abkommen und messbaren Zielen und Kennzahlen für die Umsetzung inklusiver einer finanziellen und strategischen Planung.
Beispiel Immobilienwirtschaft: der CRREM-Pfad
Der CRREM-Pfad (Carbon Risk Real Estate Monitor) ist ein Steuerungsinstrument für die strategische Immobilienpositionierung. Wissenschaftlich fundierten Dekarbonisierungspfade ermöglichen es Unternehmen, ihre Gebäudeportfolios, paris-konform auszurichten und Klimarisiken transparent zu machen.
Der Immobiliensektor muss sein CO2-Budget drastisch reduzieren, da die verfügbaren Emissionsbudgets schneller aufgebraucht werden als prognostiziert. Ohne nachhaltige Effizienzmaßnahmen erreichen Objekte den kritischen "Stranding Point", ab dem sie Wertminderungen durch Regularien und steigende Energiekosten unterliegen. Die CRREM-Pfade fungieren somit als Frühwarnsystem und Navigationsinstrument, um rechtzeitig kosteneffiziente Dekarbonisierungsmaßnahmen zu implementieren und Immobilienportfolios zukunftssicher zu positionieren.
Quelle: CREEM - eigene Übersetzung
Transition oder Transformation - wie kommen wir zum Ziel?
Transitionspläne beschreiben den schrittweisen Übergang zu klimafreundlicheren Prozessen, Produkten und Dienstleistungen durch operative Maßnahmen wie Energieeffizienz-Verbesserungen, Umstellung auf erneuerbare Energien oder nachhaltige Lieferketten.
Der Hauptunterschied ist folgender: Transition bedeutet Anpassung bestehender Strukturen, Transformation deren grundlegende Neugestaltung. Transitionspläne sind kurzfristig umsetzbar, Transformationspläne benötigen langfristige Investitionen und neue Kompetenzen.
Erfolgreiche Umsetzungsstrategien im Kontext der Klimaschutzmaßnahmen kombinieren beides: Transition für sofortige Maßnahmen, Transformation als langfristige Vision.
Für welche europäischen Fördermaßnahmen es einen Klima-Transformations-/Transitionsplan braucht
Die europäischen Fördermaßnahmen sind Teil des Europäischen Green Deal, mit dem die 27 EU-Mitgliedstaaten bis 2050 klimaneutral werden wollen. In einem ersten Schritt sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 % gegenüber dem Stand von 1990 sinken. Unternehmen und Regionen müssen bei der Beantragung dieser Fördermittel konkrete Klimatransformationspläne vorlegen, die wissenschaftsbasierte Ziele, Maßnahmen zur Emissionsreduktion und einen klaren Zeitrahmen für die Umsetzung enthalten.
Folgende sind die aktuell wichtigsten Hauptförderprogramme:
- Das LIFE-Programm („L'Instrument Financier pour l'Environnement") ist das Förderinstrument der Europäischen Union für Umwelt- und Klimaschutz. Bis heute ist es das einzige EU-Programm, das sich ausschließlich diesem Zweck widmet und das Akteur*innen vor Ort bei wegweisenden Maßnahmen unterstützt Die Förderquote liegt bei Klimaprojekten in der Regel bei bis zu 60 Prozent Das Programm unterstützt die Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien und naturbasierten Lösungen.
- Der Fonds für einen gerechten Übergang ist mit 17,5 Mrd. € ausgestattet und ist ausgelegt für einen gerechten Übergang. Er ist nur für Gebiete vorgesehen, die von fossilen Brennstoffen und CO2-intensiven Industriezweigen abhängig sind, um ihnen zu helfen, klimaneutral zu werden. Die Mitgliedstaaten erhalten Zugang zum Fonds, indem sie für den Zeitraum bis 2030 territoriale Pläne für einen gerechten Übergang ausarbeiten. Diese Pläne müssen die sozialen, wirtschaftlichen und umweltbezogenen Herausforderungen der Transformation beschreiben.
Folgende sind die aktuell wichtigsten EU-Strukturfonds:
- Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Deutschland erhält von 2021 bis 2027 insgesamt knapp 9,7 Milliarden Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung Um die Ziele des Europäischen Green Deal zu unterstützen, müssen die europäischen Regionen von 2021 bis 2027 mindestens 30 Prozent der EFRE-Fördermittel in dessen "grünes" politisches Ziel 2 (Umwelt- und Klimaschutz, Klimaanpassung, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft) investieren.
- Klima-Sozialfonds Um sicherzustellen, dass der grüne Wandel gerecht und inklusiv verläuft, hat die EU einen Klima-Sozialfonds eingerichtet. Der Fonds wird bedürftigen Haushalten, kleinen Unternehmen und Verkehrsnutzern helfen, die besonders von Energie- und Verkehrsarmut betroffen sind Der Fonds wird ab 2026 anlaufen und über etwa 86,7 Milliarden Euro verfügen.
- Instrument für technische Unterstützung Über das Instrument für technische Unterstützung hilft die Europäische Kommission den nationalen Behörden bei der Konzeption und Umsetzung von Reformen zur Erreichung ihrer Klimaziele Dies umfasst die Entwicklung einer Klimapolitik, einschließlich Beratung zu Klimastrategien und Aktionsplänen sowie Unterstützung bei der Modellierung von Treibhausgasemissionen sowie die Ausarbeitung eines Aktionsplans mit einem Fahrplan für Maßnahmen, die für den Übergang zu einer klimaneutralen Wirtschaft erforderlich sind.
- Die Plattform für einen gerechten Übergang unterstützt EU-Länder und -Regionen beim gerechten Übergang. Sie fungiert als zentrale Anlaufstelle und Helpdesk und bietet umfassende technische Hilfe und Beratung.
BAFA-Förderung Modul 5
Die BAFA-Förderung Modul 5 unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung der eigenen Transformation hin zur Treibhausgasneutralität als strategischer Baustein für eine fundierte Dekarbonisierungsstrategie. Die Förderquote beträgt für große Unternehmen 40%, für mittlere Unternehmen 50% und für kleine Unternehmen 60% der förderfähigen Investitionskosten. Die maximale Fördersumme beträgt 60.000 € pro Standort, bei Mitgliedschaft in einem Energieeffizienz- und Klimaschutz-Netzwerk steigt diese auf 90.000 €
Konkret müssen mindestens 40% Reduktion innerhalb der ersten 10 Jahre und langfristige Klimaneutralität bis 2045 als Ziele definiert werden. Anders als bei den Modulen 1-4 und 6 erfolgt die Antragstellung für Transformationspläne über den Projektträger VDI/VDE Innovation + Technik GmbH. Es können kontinuierlich Anträge gestellt werden, aktuell mit einer Einreichungsfrist bis zum 31.8.25
Fazit
Transformations- bzw. Transitionspläne entwickeln sich vom regulatorischen "Must-have" zum strategischen Erfolgsfaktor. Die Kombination aus gesetzlichen Anforderungen zur Transformation bzw. Transition, abrufbaren Fördermitteln und konkreten Umsetzungstools wie z.B CRREM für die Immobilienbranche machen Transformations- bzw. Transitionspläne wirtschaftlich darstellbar. Erfolgreiche Unternehmen verbinden operative Transition mit strategischer Transformation - für Resilienz, Kapitalzugang und Wettbewerbsvorteile in den angestrebten klimaneutralen und nachhaltigen Märkten von morgen.