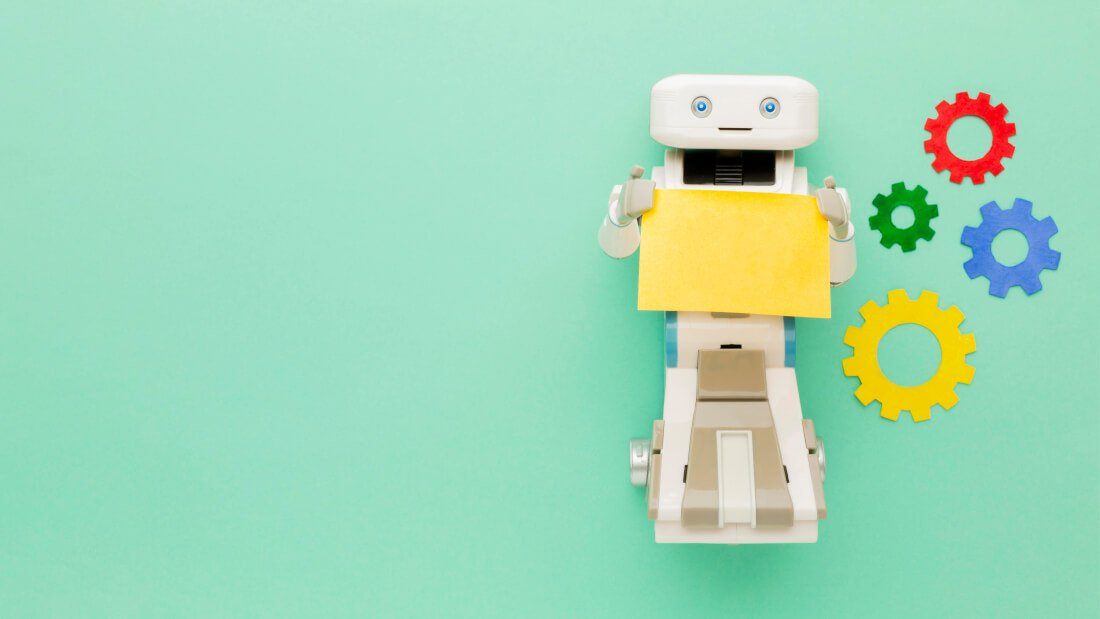Update zur CSRD-Umsetzung in Deutschland: Der Regierungsentwurf im Detail
Deutschland setzt CSRD um: Gestaffelte Berichtspflicht ab 2025 für große Unternehmen, ab 2028 für KMU. Integration in Lagebericht, Prüfungspflicht und ESRS-Standards. Deutsche Besonderheiten bei Mitbestimmung und Übergängen inklusive.
Endlich Klarheit: Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland
Regierungsentwurf zur Umsetzung der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) beschlossen. Mit erheblicher Verspätung – die ursprüngliche Umsetzungsfrist endete bereits am 6. Juli 2024 – nimmt Deutschland nun Anlauf, die europäischen Vorgaben zur Nachhaltigkeitsberichterstattung in nationales Recht zu überführen. Die EU-Kommission hat bereits ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet. Was bedeutet der Regierungsentwurf konkret für deutsche Unternehmen?
Die Abweichungen zur Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD, Richtlinie (EU) 2022/2464) im Überblick
Nachhaltigkeitsberichterstattung: Vom Nice-to-have zum Pflichtprogramm
Die CSRD markiert einen Paradigmenwechsel in der europäischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. War die bisherige nichtfinanzielle Erklärung vor allem für große börsennotierte Unternehmen relevant, weitet der Regierungsentwurf den Anwendungsbereich massiv aus. Nach aktuellen Schätzungen des BMJV werden nach vollständiger Umsetzung aller EU-Erleichterungen (insbesondere der Omnibus I-Initiative) noch bis zu 3.900 Unternehmen in Deutschland berichtspflichtig sein – deutlich weniger als ursprünglich befürchtet, aber immer noch eine erhebliche Ausweitung gegenüber dem Status quo.
Diese Reduzierung von ursprünglich ca. 15.000 auf 3.900 Unternehmen zeigt, dass die EU-Kommission die Komplexität der CSRD-Anforderungen unterschätzt hat. Die Omnibus I-Initiative ist eine direkte Reaktion auf massive Kritik aus der Wirtschaft. Dennoch: Auch 3.900 Unternehmen bedeuten einen enormen Implementierungsaufwand – viele mittelständische Unternehmen sind darauf noch nicht vorbereitet.
Der Fahrplan: Drei Wellen bis zur vollständigen Umsetzung
Der deutsche Gesetzgeber sieht eine gestaffelte Einführung in drei Wellen vor:
Erste Welle (ab 1. Januar 2025): Den Anfang machen die bereits zur nichtfinanziellen Berichterstattung verpflichteten Unternehmen mit mehr als 1.000 Arbeitnehmern. Diese Gruppe von Unternehmen muss bereits für das laufende Geschäftsjahr 2025 berichten – ein ambitionierter Zeitplan, der einige Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen stellt.
Zweite Welle (ab 1. Januar 2027): Hier zeigt sich eine bedeutende deutsche Besonderheit. Der Regierungsentwurf greift bereits den noch nicht verabschiedeten Vorschlag der Omnibus I-Initiative auf und verschiebt die Berichtspflicht für Unternehmen mit 501 bis 1.000 Arbeitnehmern auf 2027. Damit soll verhindert werden, dass diese Unternehmen nur für einen sehr kurzen Übergangszeitraum berichten müssten. Ab 2027 werden zudem alle bilanzrechtlich großen Unternehmen erfasst – unabhängig von ihrer Kapitalmarktorientierung.
Dritte Welle (ab 1. Januar 2028): Die letzte Gruppe umfasst kapitalmarktorientierte kleine und mittelgroße Unternehmen, kleine und nicht komplexe Institute sowie firmeneigene Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen. Erstmals werden auch Drittstaatenunternehmen mit bedeutender EU-Präsenz erfasst.
Rechtliches Risiko: Die Omnibus I-Initiative ist noch nicht beschlossen. Sollte sie wider Erwarten scheitern oder anders ausfallen, müssten die nationalen Regelungen erneut angepasst werden. Unternehmen mit 501-1.000 Mitarbeitern sollten sich daher nicht zu sicher fühlen – eine Vorbereitung auf 2025 wäre risikoärmer.
Zeitplan: Wann muss was erledigt sein?
Wichtig: Unternehmen der Welle 1 befinden sich bereits im Berichtsjahr – die Zeit für unverbindliche Pilotprojekte ist vorbei!
Vom Anhang zum Kernstück: Nachhaltigkeitsbericht wird Lageberichtsbestandteil
Eine zentrale Neuerung des Regierungsentwurfs: Die bisherige nichtfinanzielle Erklärung, die als separater Abschnitt im Lagebericht oder als eigenständiges Dokument veröffentlicht werden konnte, wird durch einen integrierten Nachhaltigkeitsbericht ersetzt. Dieser wird zum festen Bestandteil des Lageberichts (§§ 289b Abs. 1, 315b Abs. 1 HGB-E) und muss als klar erkennbarer Abschnitt ausgewiesen werden. Diese Integration hat weitreichende Konsequenzen: Der Nachhaltigkeitsbericht unterliegt denselben Governance-Anforderungen wie der Finanzlagebericht. Er muss vom Vorstand verantwortet, vom Aufsichtsrat geprüft und extern durch Wirtschaftsprüfer geprüft werden. Die Trennung zwischen "harten" Finanzdaten und "weichen" Nachhaltigkeitsinformationen wird damit endgültig aufgehoben.
Die schiere Menge an Datenpunkten überfordert viele Unternehmen. In der Praxis zeigt sich: Selbst große DAX-Konzerne kämpfen mit der Datenerfassung, insbesondere bei Scope 3-Emissionen und Wertschöpfungsketteninformationen. Für den Mittelstand ist dies ohne erhebliche Investitionen in IT-Systeme und Personal kaum zu bewältigen. Unternehmen müssen Informationen zu folgenden Bereichen offenlegen (§§ 289c Abs. 2-5, 315c Abs. 1 HGB-E):
Strategie und Geschäftsmodell: Wie ist das Geschäftsmodell mit dem Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft und dem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 vereinbar? Wie wird die Erderwärmung auf 1,5°C begrenzt? Diese Anforderungen gehen weit über bisherige Berichtspflichten hinaus und verlangen eine grundlegende strategische Auseinandersetzung.
Governance: Welche Rolle spielen Vorstand, Aufsichtsrat und Verwaltungsorgane bei Nachhaltigkeitsthemen? Sind Anreizsysteme mit Nachhaltigkeitszielen verknüpft? Die Integration von ESG-Kriterien in Vergütungssysteme wird damit transparent.
Sorgfaltspflichten und Auswirkungen: Unternehmen müssen ihre tatsächlichen und potenziellen negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsaspekte beschreiben – und zwar entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dies schließt Lieferanten, Geschäftspartner und Kunden ein. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um negative Auswirkungen zu verhindern, zu mindern oder zu beheben?
Risiken, Chancen und Auswirkungen: Die doppelte Wesentlichkeitsperspektive der CSRD verlangt sowohl die Darstellung, wie Nachhaltigkeitsaspekte das Unternehmen beeinflussen (Outside-in = finanzielle Wesentlichkeit), als auch wie das Unternehmen auf Umwelt und Gesellschaft wirkt (Inside-out = Wirkungswesentlichkeit).
Ziele und Indikatoren: Zeitgebundene, messbare Nachhaltigkeitsziele müssen definiert und mit relevanten KPIs unterlegt werden.
Die Wesentlichkeitsanalyse bleibt Herzstück der CSRD-Umsetzung
Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse (Double Materiality Assessment, DMA) ist der zentrale Prozess zur Identifikation relevanter Nachhaltigkeitsthemen. Sie bestimmt, über welche ESRS-Themen ein Unternehmen berichten muss.
Viele Unternehmen unterschätzen den Aufwand und die Bedeutung der Wesentlichkeitsanalyse. Eine unzureichende DMA führt dazu, dass entweder zu wenig (rechtliches Risiko) oder zu viel (unnötiger Aufwand) berichtet wird. Externe Beratung ist in den meisten Fällen unvermeidbar.
Die Wertschöpfungskette: Herausforderung mit Übergangsregelung
Eine der größten Herausforderungen der CSRD-Umsetzung: Die Berichtspflicht erstreckt sich auf die gesamte Wertschöpfungskette (§§ 289c Abs. 4, 315c Abs. 1 HGB-E). Unternehmen müssen also nicht nur über ihre eigenen Aktivitäten berichten, sondern auch über Auswirkungen und Risiken bei Lieferanten, in der Produktion und beim Vertrieb.
Der deutsche Gesetzgeber hat erkannt, dass dies nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. Daher sieht der Regierungsentwurf eine dreijährige Übergangsfrist vor (Artikel 96 Abs. 5 und 97 Abs. 4 EGHGB-E): Wenn Informationen zur Wertschöpfungskette fehlen, muss dies begründet und erläutert werden, wie die Informationen zukünftig beschafft werden sollen. Diese Erleichterung verschafft Unternehmen Zeit, ihre Datenerfassungssysteme und Lieferantenmanagement-Prozesse aufzubauen.
Die dreijährige Übergangsfrist ist praktisch unvermeidbar, aber sie schiebt das Problem nur auf. Unternehmen sollten die Zeit aktiv nutzen, nicht als "Aufschub" verstehen. Empfehlung: Vertragliche Verpflichtungen in neuen Lieferantenverträgen schon jetzt verankern.
Erleichterungen für KMU: Reduzierter Berichtsumfang
Kapitalmarktorientierte kleine und mittelgroße Unternehmen erhalten einen reduzierten Berichtsumfang (§ 289d HGB-E). Sie müssen lediglich berichten über:
- Kurze Beschreibung von Geschäftsmodell und Strategie
- Unternehmenspolitik zu Nachhaltigkeitsaspekten
- Wichtigste negative Auswirkungen und Maßnahmen
- Wichtigste Risiken und deren Handhabung
- Schlüsselindikatoren
Die Berichterstattung soll nach noch zu erlassenden KMU-spezifischen ESRS erfolgen (gemäß Artikel 29c BilanzRL). Diese Standards sind derzeit von der EU-Kommission in Entwicklung und werden voraussichtlich weniger detailliert sein als die vollständigen ESRS.
KMU profitieren auch vom späteren Einstieg (erst ab 2028) und können für weitere zwei Jahre von der Berichterstattung absehen (Opt-out bis 2030), wenn sie dies transparent machen.
"Reduziert" bedeutet nicht "einfach". Auch KMU müssen eine vollständige Wesentlichkeitsanalyse durchführen. Die KMU-Standards werden voraussichtlich 200-400 Datenpunkte umfassen – immer noch erheblich. Zudem: Große Unternehmen werden ihre KMU-Zulieferer zur Datenlieferung drängen, unabhängig von deren eigener Berichtspflicht.
Neuland: Drittstaatenunternehmen im Fokus
Eine echte Innovation der CSRD: Erstmals werden auch Drittstaatenunternehmen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet (§§ 315h-315k HGB-E).
Voraussetzungen:
- EU/EWR-weite Umsatzerlöse von mehr als 150 Mio. EUR (in zwei aufeinanderfolgenden Jahren)
- UND entweder ein bilanzrechtlich großes oder kapitalmarktorientiertes Tochterunternehmen in Deutschland
- ODER eine Zweigniederlassung mit Umsatzerlösen über 40 Mio. EUR
Der Nachhaltigkeitsbericht muss entweder nach ESRS oder nach gleichwertigen internationalen Standards (z.B. künftig ISSB-Standards gemäß Artikel 23 Abs. 4 TransparenzRL) erstellt werden. Diese Regelung soll sicherstellen, dass auch außereuropäische Konzerne mit signifikanter EU-Präsenz transparent über ihre Nachhaltigkeitsleistung berichten.
Konzernverflechtungen: Komplexe Befreiungsregelungen
Der Regierungsentwurf enthält detaillierte Regelungen zur Konzernbefreiung. Grundprinzip: Tochterunternehmen können unter bestimmten Voraussetzungen von der Berichtspflicht befreit werden, wenn sie in den konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht des Mutterunternehmens einbezogen werden.
Bei EU-Mutterunternehmen (§§ 289b Abs. 2, 315b Abs. 2 HGB-E) ist die Befreiung relativ unkompliziert: Einbeziehung in den Konzernlagebericht nach EU-Vorgaben genügt. Allerdings müssen im Lagebericht des Tochterunternehmens bestimmte Angaben gemacht werden (u.a. Name und Sitz des befreienden Mutterunternehmens gemäß § 289b Abs. 4 HGB-E).
Bei Drittstaaten-Mutterunternehmen (§§ 289b Abs. 3, 315b Abs. 3 HGB-E) sind die Anforderungen strenger:
- Einbeziehung in konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht des Mutterunternehmens
- Berichterstattung nach ESRS oder gleichwertigen Standards nach Artikel 23 Abs. 4 Unterabs. 3 TransparenzRL
- Prüfung nach nationalen Vorgaben des Drittstaates
- Offenlegung entsprechend handelsrechtlicher Vorgaben
- Erfüllung der EU-Taxonomieverordnung (entweder im Tochter- oder Mutterunternehmenslagebericht)
Wichtige Einschränkung: Große kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen können nicht befreit werden (§§ 289b Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 Satz 2 HGB-E) – sie müssen immer einen eigenen Nachhaltigkeitsbericht erstellen. Für Mutterunternehmen selbst gibt es eine Erleichterung: Wenn sie einen Konzernlagebericht mit Nachhaltigkeitsbericht erstellen, entfällt die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Einzelebene (§ 289b Abs. 5 HGB-E).
Sonderkonstellation: Tochterunternehmen von Drittstaaten-Mutterunternehmen können zeitlich begrenzt von der Berichtspflicht befreit werden, wenn sie in einen konsolidierten Nachhaltigkeitsbericht eines EU-Schwesterunternehmens einbezogen werden (Artikel 96 Abs. 6 und 97 Abs. 5 EGHGB-E).
Corporate Governance: Deutsche Mitbestimmung trifft EU-Recht
Der Regierungsentwurf enthält mehrere Anpassungen im Bereich Corporate Governance, die teilweise über die EU-Vorgaben hinausgehen:
- Arbeitnehmervertreterbeteiligung (§§ 289b Abs. 6, 315b Abs. 5 HGB-E): Eine spezifisch deutsche Regelung sieht vor, dass Arbeitnehmervertreter auf geeigneter Ebene über die Inhalte des Nachhaltigkeitsberichts unterrichtet werden müssen. Stellungnahmen sind an das für die Prüfung verantwortliche Organ zu übermitteln. Diese Regelung stärkt die Mitbestimmungsrechte und trägt der Tatsache Rechnung, dass Nachhaltigkeitsthemen oft erhebliche Auswirkungen auf Arbeitnehmer haben.
- Prüfungsausschuss (§ 107 Abs. 3 AktG-E, § 324m HGB-E): Der Prüfungsausschuss muss sich künftig auch mit der Überwachung des Nachhaltigkeitsberichterstattungsprozesses befassen. Bei Unternehmen von öffentlichem Interesse ist dies zwingend erforderlich (§ 107 Abs. 4 S. 2 AktG-E).
- Aufsichtsrat (§§ 170 Abs. 3, 171 Abs. 1 AktG-E): Als Bestandteil des Lageberichts wird der Nachhaltigkeitsbericht Gegenstand der Prüfung durch den Aufsichtsrat. Dies erhöht die Governance-Anforderungen erheblich.
- Versicherungen (Eide) (§§ 289h, 315f HGB-E): Die bisherigen separaten Versicherungen zum Jahresabschluss und Lagebericht ("Bilanzeid" und "Lageberichtseid") können künftig zusammengefasst werden. Die Versicherung muss sich dann auch auf den Nachhaltigkeitsbericht erstrecken.
- Prüfung: Von der Durchsicht zur Vollprüfung: Der Nachhaltigkeitsbericht muss von einem Wirtschaftsprüfer oder einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden (§§ 324b, 324c, 324e HGB-E). Die Bestellung erfolgt durch die Haupt- bzw. Gesellschafterversammlung (§ 324d HGB-E, § 119 Abs. 1 AktG-E) – analog zum Abschlussprüfer.
Für den Übergang sieht der Regierungsentwurf zwei wichtige Erleichterungen vor:
- Automatische Bestellung: Für vor dem 1. Januar 2026 beginnende Geschäftsjahre gilt der bestellte Abschlussprüfer kraft gesetzlicher Fiktion als Prüfer des Nachhaltigkeitsberichts (Artikel 96 Abs. 2 und 97 Abs. 2 EGHBG-E). Unternehmen müssen also nicht sofort eine separate Wahl durchführen.
- Prüferische Durchsicht statt Vollprüfung: Zunächst erfolgt die Prüfung als prüferische Durchsicht zur Erlangung begrenzter Prüfungssicherheit (limited assurance, Artikel 99 EGHGB-E). Dies entspricht einem niedrigeren Prüfungsstandard als die Jahresabschlussprüfung. Der Übergang zu einer Prüfung mit hinreichender Sicherheit (reasonable assurance) ist für die Zukunft geplant, sobald die EU die entsprechenden Prüfungsstandards erlässt.Das Ergebnis der Prüfung wird in einem gesonderten Prüfungsvermerk dokumentiert (§ 324i Abs. 1 HGB-E) – zusätzlich zum Bestätigungsvermerk für den Jahresabschluss.
- Prüfungsstandards in der Entwicklung: Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) entwickelt derzeit den IDW PS 983 n.F. für die Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten. Dieser orientiert sich am internationalen ISAE 3000 (Revised).
Was bedeutet "Limited Assurance"?
- Prüfungsumfang: Weniger umfangreich als Jahresabschlussprüfung
- Prüfungshandlungen: Überwiegend Befragungen und analytische Prüfungshandlungen, weniger detaillierte Einzelfallprüfungen
- Prüfungsurteil: Negativ formuliert ("Uns sind keine Sachverhalte bekannt, die...") statt positiv ("Nach unserer Beurteilung entspricht...")
- Prüfungssicherheit: Mindestens 50% Sicherheit (bei Reasonable Assurance: >95%)
Diese Regelung stellt dennoch hohe Anforderungen an Wirtschaftsprüfer: Sie müssen ihre Kompetenzen im Bereich Nachhaltigkeitsberichterstattung massiv ausbauen. Die Wirtschaftsprüferordnung wird daher angepasst, um Aus- und Fortbildungsanforderungen zu definieren.
Digital first: ESEF und maschinenlesbare Berichterstattung
Der Regierungsentwurf schreibt die Aufstellung des Lageberichts im European Single Electronic Format (ESEF) vor (§§ 289g, 315e HGB-E). Dies bedeutet:
- Lagebericht im XHTML-Format
- Maschinenlesbare Auszeichnung der Nachhaltigkeitsangaben mittels XBRL-Taxonomie
Die Formatvorgaben sind erstmals für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen (Artikel 96 Abs. 7 und 97 Abs. 6 EGHGB-E). Dies verschafft Unternehmen etwas Zeit, ihre Systeme anzupassen.Die maschinenlesbare Auszeichnung ermöglicht die automatisierte Auswertung und den Vergleich von Nachhaltigkeitsinformationen über Unternehmen hinweg. Investoren, Analysten und Aufsichtsbehörden erhalten damit deutlich bessere Möglichkeiten zur Datennutzung.
Da die technischen Standards der EU-Kommission noch nicht final vorliegen, erhält das BMJV eine Ermächtigung, die konkreten Anforderungen per Rechtsverordnung zu regeln, sobald die EU-Vorgaben vorliegen.
Praktische ESEF-Herausforderungen:
- Standard-Office-Software reicht NICHT aus – spezialisierte Tools erforderlich
- XBRL-Tagging erfordert technisches Know-how
- Die ESRS-XBRL-Taxonomie umfasst mehrere tausend Tags
- Viele Softwareanbieter entwickeln noch ihre Lösungen – Markt ist im Aufbau
- Kosten: ESEF-Software zwischen 5.000-50.000 EUR/Jahr, abhängig von Unternehmensgröße
Offenlegung: Transparenz für alle
Der Lagebericht einschließlich Nachhaltigkeitsbericht und Prüfungsvermerk muss beim Unternehmensregister in deutscher Sprache offengelegt werden (§ 325 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 3 HGB-E). Die Übermittlung erfolgt elektronisch im ESEF-Format (§ 11 Abs. 2 URV-E).Diese öffentliche Verfügbarkeit stellt sicher, dass alle Stakeholder – von Investoren über NGOs bis zu interessierten Bürgern – Zugang zu den Nachhaltigkeitsinformationen haben. Für Drittstaatenunternehmen gelten besondere Offenlegungsvorschriften (§§ 328a und 328b HGB-E).
- Sanktionen bei Nichteinhaltung: Zwar enthält der RegE keine expliziten neuen Bußgeldtatbestände, jedoch gelten die allgemeinen Regelungen:
- Verspätete Offenlegung: Ordnungsgeld bis zu 25.000 EUR (§ 335 HGB)
- Unrichtige Darstellung: Bußgeld bis zu 50.000 EUR (§ 334 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
- Bei vorsätzlicher Falschdarstellung durch Organmitglieder: Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe (§ 331 Nr. 1 HGB)
Deutsche Besonderheiten: Wo der RegE über die EU hinausgeht
Der deutsche Regierungsentwurf enthält mehrere Regelungen, die über die Mindestvorgaben der CSRD hinausgehen oder EU-Entwicklungen vorwegnehmen:
- Omnibus I-Vorgriff: Die Verschiebung für Unternehmen mit 501-1.000 Arbeitnehmern auf 2027 nimmt eine noch nicht verabschiedete EU-Änderung vorweg. Die Bundesregierung setzt darauf, dass die Omnibus I-Initiative wie erwartet beschlossen wird.
- Stop-the-clock-RL bereits integriert: Die zweijährige Verschiebung für Wellen 2 und 3 ist bereits im RegE enthalten, obwohl die Umsetzungsfrist erst zum 31. Dezember 2025 endet.
- Arbeitnehmervertreterbeteiligung: Die Unterrichtungs- und Stellungnahmerechte für Arbeitnehmervertreter gehen auf deutsche Mitbestimmungstraditionen zurück und finden sich so nicht in der CSRD.
- Konzernbefreiung für Drittstaaten-Töchter: Die zeitlich begrenzte Möglichkeit der Befreiung bei Einbeziehung in den Bericht eines EU-Schwesterunternehmens ist eine pragmatische deutsche Lösung für komplexe Konzernstrukturen.
Ausblick: Was kommt als nächstes?
Der Regierungsentwurf ist erst ein Meilenstein im Gesetzgebungsprozess. Nun folgen:
- Stellungnahme des Bundesrats
- Drei Lesungen im Bundestag
- Ausschussberatungen (hier sind noch Änderungen möglich)
- Zustimmung des Bundesrats
- Unterzeichnung durch den Bundespräsidenten
- Verkündung im Bundesgesetzblatt
Parallel arbeitet die EU an weiteren Anpassungen:
- Omnibus I-Initiative: Umfassende Vereinfachungen und Anpassungen der CSRD werden verhandelt. Die Bundesregierung unterstützt diese Initiative ausdrücklich und will die Ergebnisse möglichst noch im laufenden Gesetzgebungsverfahren berücksichtigen.
- KMU-Standards: Die EU-Kommission muss noch die vereinfachten ESRS für KMU erlassen (voraussichtlich Q1 2026).
- ESRS für Drittstaatenunternehmen: Auch hier stehen spezifische Standards noch aus.
- Sektorspezifische ESRS: Standards für energieintensive Branchen, Finanzsektor und weitere Sektoren in Entwicklung (geplant 2026-2028).
- Prüfungsstandards: Standards für die Prüfung mit hinreichender Sicherheit werden entwickelt.
- ESEF-Taxonomie: Die technischen Details zur maschinenlesbaren Auszeichnung von Nachhaltigkeitsinformationen werden finalisiert.
Fazit: Paradigmenwechsel mit Herausforderungen – aber auch Chancen
Der CSRD-Regierungsentwurf markiert einen fundamentalen Wandel in der deutschen Unternehmensberichterstattung. Nachhaltigkeitsinformationen werden von der Kür zur Pflicht, von der Kommunikation zur prüfpflichtigen Rechenschaft. Die Integration in den Lagebericht und die Prüfungspflicht schaffen eine neue Qualität der Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Die CSRD ist ein ambitioniertes, aber auch überkomplexes Regelwerk. Die Reduzierung der betroffenen Unternehmen von 15.000 auf 3.900 durch Omnibus I zeigt: Die EU hat die Umsetzbarkeit anfangs falsch eingeschätzt. Weitere Vereinfachungen sind wahrscheinlich – aber darauf sollten sich Unternehmen nicht verlassen. Die dreijährige Übergangsfrist bei der Wertschöpfungskette ist realistisch, aber sie ist kein Freibrief. Unternehmen müssen die Zeit aktiv nutzen. Nach drei Jahren gibt es keine Ausreden mehr. Die größte Gefahr: CSRD als reines Compliance-Projekt zu verstehen. Unternehmen, die Nachhaltigkeit nur als Berichtspflicht sehen, werden den Aufwand haben, aber nicht den Nutzen. Die Chance liegt darin, die CSRD als Anlass für eine echte „nachhaltige und digitaleTransformation“ zu nutzen.
Unternehmen der ersten Welle müssen bereits für 2025 berichten. Wer noch nicht begonnen hat, seine Nachhaltigkeitsberichterstattung auf CSRD-Niveau zu heben, sollte JETZT handeln. Die Zeit für unverbindliche Pilotprojekte ist vorbei – jetzt geht es um die Umsetzung.